Das Objekt klein a (frz. „objet petit a„) bezeichnet in der Theorie von Jacques Lacan das Objekt des Begehrens – nicht als greifbares oder bestimmbares Ding, sondern als das, was das Begehren antreibt. Es ist die Ursache des Begehrens, nicht sein Ziel.
Das objet petit a ist dabei kein wirkliches Objekt, sondern eher mit einem Schatten vergleichbar. Es zeigt an, dass dem Subjekt etwas fehlt – aber dieses „Etwas“ kann aber nie ganz erfasst oder benannt werden. Das objet petit a bleibt für das Begehren ein nicht fassbares Ziel, es bleibt immer in Bewegung, es springt von Objekt zu Objekt – in der Hoffnung auf Erfüllung, die aber nie eintritt.
Funktion bei Lacan: Das objet petit a entsteht durch eine grundlegende Erfahrung des Mangels: Das Kind verliert in der Subjektwerdung etwas, das es nicht benennen kann – eine imaginäre Ganzheit, die aber nie wirklich vorhanden war. Dieser Mangel prägt das Begehren, das sich von nun an immer auf etwas richtet, das dieses „verlorene Etwas“ ersetzen soll. Da das objet petit a aber selbst eine Leerstelle ist, kann es nie vollständig erreicht werden. Es gehört weder zur symbolischen noch zur realen Ordnung, sondern wirkt als „Lücke“ in der symbolischen Struktur – ein Störfaktor, der das Begehren in Bewegung hält.

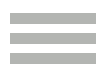 Moderne Deutung: Klarheit und
Moderne Deutung: Klarheit und 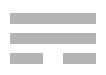 Moderne Deutung: Durchsetzungskraft; Denken, Planen, Handeln; geistige Fähigkeiten; Einsicht
Moderne Deutung: Durchsetzungskraft; Denken, Planen, Handeln; geistige Fähigkeiten; Einsicht Das Tàijí-Symbol zeigt, wie
Das Tàijí-Symbol zeigt, wie 
